Aphorismen
Das grundlose Zeitalter. - Eine gut begründete Meinung zu haben, wird angesichts der Überfülle streitender Autoritäten und undurchschaubarer Zusammenhänge immer unmöglicher. In vollendeter Grundlosigkeit bleiben endlich nur zwei Haltungen: die des aufrichtig Unwissenden und die des anmaßend Wissenden. Redlichkeit und Wissen schließen dann einander aus. Die Lügner werden herrschen, Logik wird veralten, Rhetorik und Gewalt einander durchdringen.
Je genauer und redlicher man denkt, desto weniger Gedanken bleiben einem.
Wer viel meint, also viel zu wissen glaubt, war einfach weniger wählerisch in seinen Gründen. Je ehrlicher man mit sich selbst ist, desto meinungsschwächer wird man.
Gordische Zeichen. – Wir haben die Jahrtausende verlassen, in denen Wahrheit und Klarheit zusammenklangen. Heute wird wie mit Alexanders Schwert die Klarheit in das ineinander verschlungene Welt-Zeichen-Chaos geschlagen um des Weges, der Bewegung und Befreiung willen – wohin auch immer sie am Ende führen mag …
Wahrheit und Klarheit reimen sich zu Unrecht.
(Mai 2025)
Die protestantische Ethik in der Literaturkritik
Warum James Baldwin nicht der "Klassiker" ist, zu dem er gemacht werden soll
Wir leben, seit es rasend sich vermehrende Zeichen gibt, so sehr in unseren Fiktionen, dass der angeblich wesentliche Unterschied zwischen Fiktion und Realität immer unwesentlicher geworden ist. Einen Großteil unseres westlichen Lebens verbringen wir in künstlichen Welten, Kunstprodukten, Spielen, Narrativen, Moden, denen man keinen Wahrheitswert zuordnen kann. Diese Website ist ein Beleg dafür, wie wir versuchen, trotzdem oder gerade deshalb eine plausible Ordnung in das fiktive Universum hineinzubegründen. Aus einer aufklärerischen Manier fühlen wir uns verpflichtet, hin und wieder durch ein Wurmloch in die parallele Wirklichkeit zu tauchen, unsere Fiktionen an ein Stück echter Welt zu knüpfen und beides miteinander zu verwechseln …
Wie unsere Gegenwart Literatur behandelt, ist hierfür ein Musterbeispiel. Obwohl wir wissen, dass literarische Texte völlig anderen Regeln unterliegen als die Wirklichkeit - weniger und willkürlichen Regeln vor allem, so dass man weder von freien Figuren oder Strukturen auf freie (oder unfreie) Menschen schließen kann noch umgekehrt - werden gerade erzählende Texte inzwischen nur noch selten an literarischen Maßstäben gemessen, sondern lieber an solchen, die auch für Compliance, Marktwirtschaft und Demokratie angeblich gelten: Es soll gerecht und effizient zugehen. Nutzen und Moral hat Vorrang - eine Schnittmenge von Kunst und Calvinismus (Tanzen verboten!) ist das Leitbild. Schriftsteller und Internatsleiter sind gleichermaßen für die Sorgen ihrer Anvertrauten und ein pädagogisch fruchtbringendes Programm verantwortlich. (Dass man sich kaum in einem von Dante oder Aischylos geleiteten Internat, durchaus aber in den von ihnen geleiteten Texten wohlfühlen kann, wird dabei nicht bedacht.) Aus Angst vorm bodenlos Fiktiven unsrer Zeichen-Welt, so scheint es, wollen wir immerhin die Mannigfaltigkeit unserer Fiktionen reduzieren.
Realistische Schriftsteller, die die Gesellschaft ihrer Zeit erzählen, werden folgerichtig seltener als reale Architekten der Fiktion behandelt denn vielmehr als fiktive Architekten der Gesellschaft. Es ist für Laien interessanter, Autoren über politische als schreibtechnische Probleme reden zu hören. Alle Künstler nehmen diese Prestige- und Publicitysteigerung, die mit dem Hütchenspieler-Tausch von Werk und Welt einhergeht, gerne an: als hinge von ihrem kreativen Blick, wie von einem pharmazeutischen Patent, ganz faktisch etwas ab. Für den hier angenommenen Zusammenhang zwischen künstlerischen und politischen Kompetenzen spricht allerdings - was niemand übrigens bestreitet - gar nichts. Eine Welt zu erschaffen ist weiß Gott von jeher einfacher als eine zu verändern.
James Baldwin ist zugleich Opfer und Profiteur dieser Verwechslung. Zu seinem hundertsten Geburtstag in diesem Jahr wurde er zwar in allen wichtigen Medien auch im deutschsprachigen Raum überschwänglich gefeiert; jedoch galt der Überschwang deutlich seltener Baldwins Schreiben - das über Inhaltsangaben und pädagogische Empfehlungen abgehandelt wurde - und öfter seinem Leben als homosexuellem US-Exilanten und „Stimme der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung“.
Man mag sich an dieser Stelle, ohne das Thema erschöpfen zu wollen, kurz fragen: Wäre einem die sexuelle und politische Orientierung eines Zahnarztes auch so wichtig, dass sie den Ausschlag gäbe, ob man sich von ihm behandeln ließe? Oder hielte man den Zusammenhang von Charakter und Kompetenz, von Meinung zu A und Eignung für B für weniger zwingend? Man mag mich für überempfindlich halten, aber ich persönlich begebe mich ebenso ungern einige Stunden in die Hände eines Schriftstellers wie in die eines Zahnarztes, der seine Kunst nicht versteht. Und Baldwins literarische Behandlung, um es gleich zu sagen, hat mir vermeidbare Schmerzen verursacht. Trotzdem habe ich sie nicht abgebrochen und würde mich ihr auch wieder unterziehen. Beides möchte ich im Folgenden begründen, ohne statt des Textes das Privatleben des Autors zu rezensieren, zu dessen Beurteilung ich weder befähigt noch berechtigt bin.
„Giovannis Zimmer“, James Baldwins zweiter, 1956 erschienener Roman, schildert die Zerrissenheit des bürgerlich-angepassten Amerikaners David, der eine Affäre mit dem Kellner Giovanni eingeht, während er sich mit seiner Verlobten in Paris aufhält. Beide Beziehungen scheitern. Giovanni wird wegen Mordes an einem ihn ausnutzenden Barbesitzer zum Tode verurteilt.
Was bei der Lektüre der hochgelobten Übersetzung von Miriam Mandelkow als erstes auffällt, ist die stilistische Unsicherheit des Autors. Obwohl Baldwin oft bildhaft formuliert, stößt man in diesem Buch auf kaum einen gelungenen Vergleich, doch eine Unzahl schiefer Sätze, die nachweislich nicht die Übersetzerin verantwortet:
Da gibt es „Qual, die zu einer einzigen Leere angewachsen war“ (32), Hitze, „die aus dem Asphalt quoll und mit solcher Wucht von den Häuserwänden abprallte, dass sie einen hätte erschlagen können“ (13), wir lesen, „wie alle Erwachsenen dieser Welt, so schien es, schrill und strubbelig auf den Eingangsstufen saßen“ (13), dass eine Umarmung wirkt, „als hielte ich einen seltenen, erschöpften, beinahe todgeweihten Vogel in meiner Hand, den ich wundersamerweise gefunden hatte“ (14), von „Jungs in engen Hosen, schlank wie Rasierklingen“ (35), und von einer „Zimmerdecke, die sich senkte wie die Wolken, aus denen zuweilen Dämonen sprachen, Wolken, die ihre Bösartigkeit verschleierten, doch nicht mildern konnten hinter dem gelben Licht, das wie ein undefinierbares kranken Geschlecht in ihrer Mitte hing“ (101).
Selbst Baldwin-Fans sollte es schwerfallen, die poetische Qualität dieser Sätze zu erklären. Hier werden Bedeutungen verknüpft, die zueinander nicht passen: Was langsam „quillt“, kann nicht zugleich wuchtig „abprallen“; „Decke“, „Wolken“, „Dämonen“ und „Geschlecht“ in ein Bild zu zwingen, verhindert das Bild. Solche Katachresen (Bildbrüche) blockieren die Anschauung wie Widersprüche das Denken; sie können vom Autor nicht gewollt sein. Ebenso wenig metaphorische Kalauer wie: „Sie war füllig und beunruhigend flüssig - was ihr nicht half, in Fluss zu kommen“ (114).
Obwohl er einerseits sprachlich zu viel riskiert, drischt Baldwin andererseits doch dutzendweise Phrasen und Klischees, die auch zur Zeit der Erstveröffentlichung schon an Schnulzen erinnert haben dürften:
Tränen sind „wie Feuer“ (124), nackte Körper „unschuldig“ (15), „große durstige Leidenschaft“ lässt Herzen „zerspringen“ (14), wenn nicht, sind die Lippen „kalt“ (184), Italiener sind „theatralisch“ (150), essen Spaghetti und machen Babys (158), in Spanien hat man schnell „genug von Olivenöl und Fisch und Kastagnetten“ (107), Frauen riechen „nach Wind und Meer“ (137) und stoßen „die Tore ihrer gut befestigten Stadt weit auf, um den König der Ehre einziehen zu lassen“ (141) …
Auch die Figuren des Textes überraschen nicht. Baldwin gibt seinen Lesern, was sie von Pariser Schwulen-Bars erwarten: verlebte Tunten, klamme Lustknaben und spendable Bonvivants, den titelgebenden Südländer „von der schrecklichen Schönheit eines Pferdes“ (64) und die kontrastierende Verlobte, eine selbstbewusste Frau mit Kinderwunsch. Die bildhaften Charakterisierungen retten die Figuren nicht, im Gegenteil:
Sie stand da, todschick, wie man so sagt, der Mund röter als jedes Blut, in einem Kleid, das entweder die falsche Farbe hatte oder zu eng war oder zu jugendlich, und das Cocktailglas in ihrer Hand drohte, jeden Augenblick in Scherben zu zersplittern, während die Stimme unaufhörlich durch den Raum schnitt wie eine Rasierklinge auf Glas. (19)
Viele Seiten lauscht man faden, teils quälenden Dialogen voller Plattitüden („Na ja, wer nicht wagt, der gewinnt keinen Prinzen, so viel steht fest.“). Die schon vor Oscar Wilde beliebte Textsorte der essayistisch-ironischen Konversation, mit der Autoren wie Proust, Joyce und Musil nicht den schlechtesten Teil ihrer Werke füllen, misslingt Baldwin:
‘Ihr seid unmöglich‘, sagte ich. ‚Ihr habt doch das Erhabene kaputt gemacht, hier mitten in dieser Stadt, mit Pflastersteinen. […]‘ Er grinste. Ich schwieg.
‚Nicht aufhören‘, sagte er noch immer lächelnd. ‚Ich bin ganz Ohr.‘
Ich trank aus. ‚Ihr habt diese ganze merde über uns ausgekippt‘, sagte ich mürrisch, ‚und jetzt nennt ihr uns barbarisch, weil wir stinken.‘
Mein Murren entzückte ihn. ‚Wie charmant‘, sagt er. ‚Redest du immer so?‘
‚Nein‘, sagte ich mit gesenktem Blick. ‚Praktisch nie.‘
Er hatte etwas von einer Koketten. ‚Ich fühle mich geschmeichelt‘, sagte er plötzlich mit beunruhigendem Ernst, doch nicht ohne einen Hauch von Spott.
‚Und du?‘, fragte ich schließlich. ‚Bist du schon lange hier? Gefällt dir Paris?‘
An diesem ersten Dialog zwischen David und Giovanni, der sich über gut zehn Seiten zieht (S. 37 - 48), ist vieles ungelenk, und wer hier warum grinst, entzückt ist oder spottet, ist dem Leser so unklar wie gleichgültig. Dass Baldwin gern französische Sprachfetzen und anschließend noch einmal deren Übersetzung in die Figurenrede einfügt, nimmt den Dialogen nichts von ihrer Künstlichkeit.
Zur Ehrenrettung des Autors - dessen Oeuvre ich nicht kenne und darüber hier nicht geurteilt haben will - muss man sagen, dass sich der Zweite Teil des Buches überraschend, auch stilistisch steigert. Dennoch fallen die peinigenden Schwächen dieser Prosa auf den Autor zurück und die gern zitierte Formulierung vom „größten amerikanischen Stilisten seiner Generation“ (Colm Tóibín) wird von diesem Roman in keiner Weise eingelöst, vielleicht sogar entlarvt.
Dennoch gelingen Baldwin starke Episoden, überwiegend dort, wo der innere Kampf Davids mit seiner nicht mehr verdrängbaren Homosexualität und der daraus resultierende äußere Kampf gegen Giovanni und seine Verlobte zugleich sich verschärfen. Beiden Figuren, die ihn lieben, kann er sich nicht hingeben, weil er sich bis zuletzt unsicher bleibt, wer derjenige ist, den er ihnen geben soll. Zwischen Trieb und Anpassung erscheint die Figur David auf leidende Weise leer, ein Feigling wie viele, nach beiden Seiten. Trotzdem leiden wir als Leser mit diesem Ich-Erzähler, wenn seine heiratswillige Verlobte aus Spanien zurückgekehrt ist und beide Giovanni und einem sarkastischen Bekannten aus seiner Bar begegnen. Davids Doppelleben erzeugt ebensolche Spannung wie die Empathie mit den Figuren, die er täuscht oder verlässt.
Das zweite Kapitel des zweiten Teils, in dem er mit einer amerikanischen Bekannten schläft, um sich zu beweisen, dass ihm noch Heterosexualität gelingt, und so auf die Ankunft seiner Verlobten vorbereitet zu sein, ist dicht und eindrücklich und entschädigt für die Lektüre des Romans. Die Gefühlslagen beider Figuren werden zum einen direkt, zum anderen indirekt so schlüssig, scharfsinnig und detailreich dargestellt, dass es im positiven Sinne schwer erträglich ist. Lesend ist man die einsame Amerikanerin, die auf den charmanten Homosexuellen zu hoffen versucht, und dieser, der es angewidert, aber halbwegs anständig hinter sich bringen will, zugleich. In diesen hochproblematischen Begegnungen im letzten Drittel des Romans ärgert oder langweilt man sich auch in Dialogen kaum noch. Es wirkt fast, als schriebe Baldwin nur auf seiner Höhe, wenn die Figuren angespannt, in Not, verzweifelt sind. Die höhere Spannung der Geschichte überträgt sich auch auf ihre Form, die plötzlich passt wie eine Haut.
Baldwin ist weder Poet noch Plauderer, als die er sich zum Schaden seines Textes dennoch bemüht. Sprache ist für ihn Mittel, nicht Zweck. Als psychologisierender Beobachter, der das verschränkte Innen- und Außenleben im gesellschaftlichen wie im intimsten Leiden seiner Figuren darstellt, ist er kein subtiler Wortspieler, sondern ein ernsthaft realistischer und in diesem Sinn moralischer Autor, der statt zum Amüsement der Leserschaft für eine Wahrheit schreibt, die er literarisch zeigen will. Das verführt dazu, ihn weniger an seinem Stil als an seiner Wahrheit und Moral zu messen - an seinen eigenen Maßstäben also.
Summiert man Stärken und Schwächen des Romans und vergleicht sie mit den vielen Baldwin-Kommentaren im Jubiläumsjahr, erstaunt doch die Konfliktscheu der Kritik. Ich wiederhole meinen Eindruck, dass an diesem Schriftsteller seltener schriftstellerische als ethische Werte betont worden sind - gerade so, als hätte man nicht über seine Kandidatur für den literarischen Kanon, sondern für ein politisches Amt zu urteilen. Der Dichter als Regierender Bürgermeister seiner Fiktionen? Es ist nicht nur Ironie, eher Sarkasmus der Geschichte, dass Baldwin zu Lebzeiten unter demselben moralisierenden Blick, als Homosexueller, angegriffen wurde.
Es hieß jüngst immer wieder, Baldwin sei ein „Klassiker“. Nach dem Gesagten darf man das bezweifeln. Inhaltlich passt er gewiss in den Lehrplan des westlichen Liberalismus (den er übrigens ebenso kritisiert wie jener sich selbst). Seine Stilblüten, handwerklichen Defizite und unergiebigen Textanteile weisen ihn jedoch als zweitrangigen Autor aus, der wohl aus ideologischer Kumpanei oder geschäftlichen Interessen zum Klassiker aufgelobt werden soll. Das Prädikat „klassisch“ hat aber eine andere, nicht einfach lobende Bedeutung. Ist nicht vielmehr dann ein Text oder Autor „klassisch“ zu nennen, wenn er von unserer Weltsicht abweicht und uns dennoch durch seine Ideen, Formen und Vorstellungen einnimmt und begeistert, ja uns sozusagen zu sich zwingt fast in dem Sinn, in dem ein logischer Schluss zwingend ist - ohne nämlich individueller Prämissen zu bedürfen. Erst wenn viele verschiedene Blicke und Zeiten sich in ihm erkennen, gilt ein Text als „klassisch“.
Ob Baldwin in diesem Sinne klassisch ist, kann ich weder bejahen noch bestreiten. Und wer es tut, setzt sich dem Verdacht aus, künftige Epochen zu Claqueuren der eigenen Sicht zu degradieren und jene, die in anderem Sinne sprechen wollen, nicht für sich sprechen zu lassen. Auf den Anpassungskritiker und überzeugten Individualisten James Baldwin können sie sich dabei nicht berufen.
(Dieser Essay ist erstmals erschienen im August 2024 als Rezension auf der Website booknerds.de)
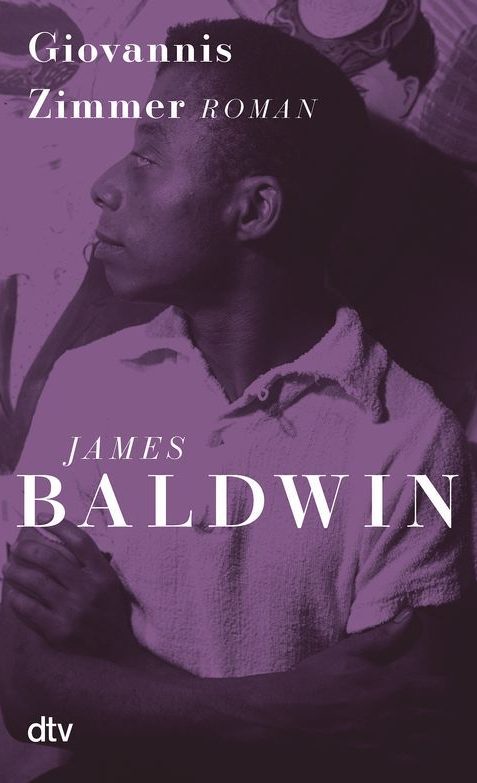

Maupassant
Maupassant lief fünftausend Meter in fünfundzwanzig Minuten,
wanderte sechzig bis achtzig Kilometer an einem Tag und
schoss auf einer Jagd siebenunddreißig Rebhühner.
Er schwamm sechs Kilometer und zog insgesamt elf
Leichen aus der Seine.
Maupassant hielt Hunde, Katzen, Goldfische, Hühner, Papageien, Schildkröten
und lernte drei- bis vierhundert Frauen intim kennen und vergessen.
An einem Pariser Abend hatte er siebzehn Einladungen.
Er schrieb täglich drei Stunden und sechs Druckseiten,
eine zweiundsiebzigseitige Novelle in vier Tagen
ohne eine einzige Korrektur.
Maupassant publizierte in zwölf Jahren achtundzwanzig Bände
sechsundzwanzigtausend Seiten (ohne die Zeitungsartikel)
verdiente an seinen Rechten achtundzwanzigtausend Francs
jährlich und erreichte in vier Monaten neununddreißig Auflagen.
(Maupassant sagte von sich:
Ich empfinde die betrügerische Infamie des
Lebens wie sie nur je einer empfunden hat.)
2004 erschienen in Frank T. Zumbach (Hg.): Das Balladenbuch, Artemis & Winkler
© 2023 Nero Campanella. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.